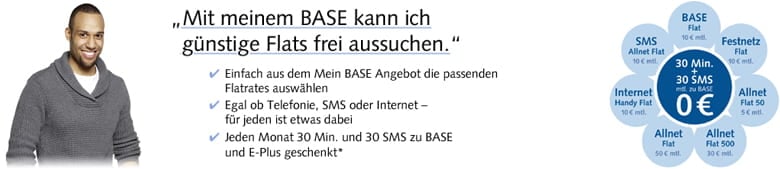Teil 1: Singapur – Sumatra

15.8. – München-Dubai-Singapur
Relaxt, an einem Montag, der auch noch Feiertag ist, um 10:40 abzufliegen. Man kann das ganze Wochenende noch rumsandeln, am Samstag die fehlende Badehose kaufen und am Sonntag Koffer packen. Dank neu erworbener Light- Reisetasche nur 19,8 kg Gepäck inkl. 2x Schwimmflossen (ja, die der Tochter auch) für über 3 Wochen. Minusrekord!
Aufgrund meiner extrem negativen Oberschenkel : Unterschenkel Beinhebelwirkung haben wir uns Business Class gegönnt. Im A380 eine feine Sache. In der 777 dann schon fast etwas enttäuschend, wenn man vorher Airbus-Luxus genossen hat.
Die Zeitverschiebung gottseidank überhaupt kein Problem und immer wieder dieses geile Gefühl, wenn Du zum ersten mal die AC Zone verlässt und dich der Temperaturunterschied voll erwischt. Das Hotel in Singapur war ein Kompromiss in der Mitte zwischen Flughafen und Downtown. Katong heißt das Viertel. aber ganz OK soweit. Kleinen Ausflug an den Strand (in den East-Park) und da erst mal kalt von den Singapuriensischen Bierpreisen erwischt worden. 8 EURO für eine Miniflasche Heinecken. Oida!
Abendessen im Satay by the Bay. Das war nett, nur Einheimische. Ein Dutzend Buden (von Satay bis Dim Sum), Campingtische in der Mitte.
Früh ins Bett – der Wecker geht um 5:30 :-/

17.8. – Singapur-Sumatra
05:30 aufstehen ist ja eigentlich die Hölle. Aber wenn man bereits jedes Gefühl für Raum und Zeit verloren hat und um 21:00 ins Bett geht, dann ist das machbar. Vor allen Dingen dann, wenn man die Nacht zu Viert in einem 20 qm großen Familienzimmer verbracht hat, und Frau und Tochter nicht völlig geräuschlos schlafen…
Silk Air war pünktlich (06:30), bequem und freundlich. Kann ich nur empfehlen. Am Flughafen in Medan (Hauptstadt von Sumatra – 4,5 Mio. Einwohner) wartete bereits ein freundlicher Taxifahrer auf uns. Er musste etwas länger warten, weil natürlich Vater, Tochter und Sohn erst einmal an den Telkomsel Schalter gestürmt sind, um sich dort mit 4,5 GB Internet für umgerechnet 8€ einzudecken.
Der Weg nach Bukit Lawang – etwa 100 km – hat uns 4 Stunden unseres Lebens gekostet. Der 17.8. ist indonesischer Independence Day, 1945 hat man sich von den Holländern befreit (etwas, was der A8 bis heute nicht gelungen ist). Unsere Vermutung, dass aufgrund des Feiertags die Straßen menschenleer sein würden, hat sich nicht nur nicht bewahrheitet, sondern wurde Lügen gestraft. Ganz Sumatra war auf den Beinen, oder besser Rädern. Die Straßen waren proppevoll mit in Schuluniformen herausgeputzten Kindern, jungen Mädchen mit Kopftüchern, Mopeds, noch mehr Mopeds, trillerpfeifenden Polizisten, Zweitaktern und uns. Teils war die (einzige) Hauptstraße gesperrt und wir wurden mit unserem Taxi durch wilde Schlaglöcher umgeleitet. Aber wir kamen an, und das ist ja irgendwie die Hauptsache.
In Bukit Lawang angekommen erwarteten uns bereits 3 Hotelangestellte (von denen, wie sich später herausstellte, einer zum Hotel gehörte, um uns unser Gepäck abzunehmen. Vom Parkplatz bis zum Bungalow waren nämlich noch etwa 2 km Strecke und etwa 250 Stufen zu erklimmen. Ich sage mal so: Hätte ich die Strecke vorher gekannt und gewußt, dass die Jungs aus dem Dorf dafür, dass sie unser Gepäck da raufasten, umgerechnet 3,50€ haben wollen – ich hätte das auch von vornherein wegdelegiert. Junior trug seine Tasche selbst und hyperventilierte bei Ankunft.
Das Hotel on the Rocks selbst ist wunderbar. Auf dem Berg, mitten im Regenwald, sehr (!) relaxt. Hier sitze ich gerade auf dem Balkon unseres Bungalows und schreibe diesen Text. Kein Warmwasser, keine Steckdose, der Duschkopf ist eine Kokosnuss – was will man mehr?!
Morgen geht es in den Dschungel!

18.8. – Bukit Lawang, Sumatra
Dschungel! Deswegen fährt man nach Bukit Lawang. Heimat der Orang Utans (ein indonesisches Wort. Orang bedeutet Mensch und Utan Wald). Für heute haben wir also die Dschungel-Tour gebucht. Beginn 09:00. Nachdem wir direkt am Eingang zum Nationalpark wohnen, bedeutete das, dass wir „erst“ um 8:00 beim Frühstück sein mussten. Easy! Da brauchen wir keinen Wecker! Mitten in der Nacht im Halbschlaf dann auf die Uhr geschaut und gesehen, dass es schon 7:45 ist. Der deutlich hörbare Dauerregen entpuppte sich als Wasserfall neben dem Bungalow, so dass wir dann doch aufgestanden sind, um uns in den Regenwald zu begeben.
Die Tour war ganz wunderbar. Es ging steil bergauf und bergab, Luftwurzeln und Lianen dienten als Kletterseile. Anstrengende Sache insgesamt. Und – was ja das Wichtigste ist: Primaten über Primaten. Orang Utans existieren in der freien Wildbahn überhaupt nur in Sumatra und Borneo. Auf beiden Inseln wird nach wie vor ausgewildert, um die Population zu stärken. In Bukit Lawang war bis Mitte der 90er Jahre eine Auswilderungsstation, in der die Tiere mit der Flasche aufgezogen und dann schrittweise an die freie Wildbahn gewöhnt wurden. Aufgrund der dann doch recht dichten Population wurde die Station 2006 geschlossen. Bis vor einem Jahr wurde sie noch zum Anfüttern der Tiere für Touristen genutzt. Aber die Affen haben sich jetzt alle ausgiebig mit der freien Wildbahn vertraut gemacht, finden überall im Übermaß Futter und sind einfach nicht mehr an die Futterstelle gekommen.
Wenn der Orang Utan nicht mehr an die Futterstelle kommt, muss der Mensch eben zum Orang Utan gehen, und das haben wir dann ja auch gemacht. Erfolgreich, wie ich betonen möchte. Man unterscheidet zwischen „Semi Wild“ (ausgewildert) und „Wild“. Die Spezies „Semiwild“ ist manchmal etwas zu zutraulich und wird leicht ungehalten, wenn man sie nicht füttert. Wir sind an einer Stelle an eine Art Orang-Utan-Straßensperre geraten. Eine Mutter mit Kind, die brettelbreit auf dem schmalen Weg saß und die wandernden Gefährten erwartungsfroh ansah. Mein Video bekam einen authentischen Blair Witch Charakter, nachdem wir dem Füttern nicht wunschgerecht nachkamen und das Tier uns daraufhin recht rasant entgegenkam…
Die Orangs, auf die wir dann recht oft trafen, waren sicherlich überwiegend an Menschen gewöhnt. Nichtsdestotrotz wohnen sie autark im Dschungel und sind keine zahmen Tiere. Schon eine Erlebnis! Affen hatten wir dann im Überfluss. Menschen übrigens auch, denn der Nationalpark ist in der Hauptsaison ziemlich gut besucht. Erst, als wir die eingetretenen Pfade verließen und über ziemlich abenteuerlich anmutende Klettersteige weiterliefen, wurde es menschenleer. Lunch dann über dem Wasserfall und danach ein erfrischendes Bad darunter. Sehr schön.
Den Rückweg legten wir dann auf aneinandergebundenen LKW-Schläuchen auf dem Fluss zurück. Eine ebenso abenteuerliche, wie preisgünstige und stabile Konstruktion, die unterm Strich problemlos 8 Passagiere trug. Ein echter Tipp für Isar-Abfahrten. Ich habe Fotos gemacht!
Wie viele Höhenmeter wir heute gemacht haben, ist mir noch unklar (das GPS lief aber mit. Muss ich noch nachtragen). Aber es waren viele. Und unser Hotel heißt „On The Rocks“ und ist etwa 250 Stufen vom Fluß aufwärts. Kein Aufzug! Brennende Oberschenkel. Jetzt ein Bintang. Bis morgen!

19.8. – Bukit Lawang, Sumatra
Immer noch Dschungel! Heute beim white water rafting auf dem Sei Wampu, dem größten Fluss hier unten, der leider nur etwas wenig Wasser in der Trockenzeit führt, so dass sich in den Stromschnellen der eine oder andere Flusskiesel ins verlängerte Rückgrat bohrt.
Geplante Abfahrt war 08:15 – no pun intended. Da der Sohn sich noch ein ausgefallenes indonesisches Frühstück bestellen musste, verzögerte sich das Ganze um 45 Minuten. Am Parkplatz erwartete uns ein Fahrzeug, das jedem Mad Max Film Ehre gemacht hätte. Ein japanisches Transportfahrzeug der ersten Baureihe, aus dessen Ladebereich offene Fenster geflext wurden und in dem wir dann face to face untergebracht wurden. Wir, das sind die Holde und ich. Der Nachwuchs kam sofort der Aufforderung nach, doch auf dem Dach platz zu nehmen. Das Dach war durch eine etwa 5 cm hohe Reling „gesichert“. Diese Art des KFZ-Transports ist hier durchaus gängig und man sieht häufiger Transporte mit 10 Personen IN und weiteren 10 Personen AUF dem Fahrzeug. Die Kids waren natürlich begeistert und kamen mit einem Sonnenbrand und leichten Abschürfungen durch herabhängende Palmwedel davon. Ein Schutzengel wäre damit verbraucht…
Nach eineinhalb Stunden Fahrt auf Sumatras Buckelpisten durch schier endlose Palmölplantagen an der Abfahrtstelle des Rafting-Trips angekommen, gab es erst einmal ein ausführliches Sicherheitsbriefing verbunden mit dem Hinweis, das wir auf jeden Fall unsere Helme aufbehalten sollen (der Hinweis, dass die Kids beim Höllentrip auf dem Dach keine Helme tragen mussten ist überflüssig, oder?).
Es folgen 5 sehr relaxte Stunden auf dem Schlauchboot durch wilde Urwaldgebiete (Filme, die mir aufgrund der Umgebung durch den Kopf gingen: African Queen – nur ohne Blutegel – und Apocalypse Now – nur ohne Vietcong) mit kreischenden Affen und Orchideen am Wegesrand a.k.a. Ufer.
Nach einigen hundert Metern lag plötzlich ein penetranter Schwefelgeruch in der Luft. Hinter einer Biegung des Flusses dann ein kleiner Wasserfall, über dem eine gelbliche Glocke lag. Darunter ein natürliches, mit dem Fluss verbundenes Becken, an dem wir zum Baden stoppten (wir waren, wie so häufig, die einzigen Menschen weit und breit. Man stelle sich vor, wie heiße Quellen in touristischeren Gegenden aussehen würden…). Die Temperatur des Wassers lag am Rand locker bei 35-40 Grad. Je näher man an den Wasserfall heranschwomm, desto unerträglicher wurden Temperatur und Geruch. Bei der Weiterfahrt stellten die Damen dann fest, dass sich sämtlicher Silberschmuck golden verfärbt hatte (unser Käptn hat das in der Mittagspause mit Hilfe von Asche dann wieder behoben).
Lunch wurde vor einem kleinen Wasserfall am Fluss eingenommen. „Indonesisches Buffet“. Es gab diverse Curries, hervorragende Tofu-Gerichte, Flussspinat (Wörter mit 3 s hintereinander \o/ ), geröstete Sojasprossen, roasted chicken und ganz viel frisches Obst. Wenn ich hier wohnen würde, würde ich wahrscheinlich zum Vegetarier werden, so gut ist das Zeug ohne Fleisch.
Die Rückfahrt war dann (natürlich) deutlich kürzer und da auf dem Dach das Schlauchbot thronte, auch insgesamt etwas sicherer.
250 Stufen nach Oben zum Hotel rundeten den Tag auf wie immer anstrengende Weise ab. Jetzt sitze ich hier bei einem Kaltgetränk, warte auf die Familie und das Dinner und freue mich auf den derzeit noch programmlosen morgigen Tag.

20.8. –Bukit Lawang, Sumatra
Ausschlafen! Nach fast einer Woche on the road und täglichem Weckruf zwischen 05:30 und 7:00 war das mal fällig. Die beiden wichtigsten und im Voraus gebuchten Programmpunkte – Dschungeltracking und Rafting – hatten wir erfolgreich absolviert, also konnten wir es heute ruhig angehen lassen.
Nach ausgiebigem Frühstück und etwas Recherche vor Ort war dann Beschlusslage, dass wir die zu Fuß erreichbaren „Bat Caves“ erobern wollten. Ein 3-teiliges Höhlensystem im benachbarten Dschungel. Corinna, die deutsche Chefin von On The Rocks, gab uns noch den wertvollen Hinweis, festes Schuhwerk anzuziehen und Wasser einzupacken. Als wir das gerade besprachen kam ihr indonesischer Mann um die Ecke, sah mich in meinem C12-T-Shirt und ratterte erst einmal die komplette Aufstellung des FC Bayern herunter. „You know Kimmich? He’s from the same village close to Stuttgart as my wife!“. Die Tour verzögerte sich also um eine halbe Stunde Bundesligafachsimpelei im primären Regenwald, dann ging es aber stramm los.
Wieder einmal hat es sich bewährt, dass ich mein gutes altes Garmin GPS mit Open Streetmap bestückt habe. Während Google Earth die Höhlen nicht kannte, waren sie auf der GPS-Karte verzeichnet und erstaunlicherweise war sogar der schlammige Pfad durch die Kautschukplantagen auf den Meter genau angegeben.
Am Eingang der Höhle saßen einige sehr entspannte Einheimische und kassierten den offiziellen Eintritt von umgerechnet 1,80€ inkl. Taschenlampe und Guide. Beides sollte, wie sich bald herausstellte, von unschätzbarem Wert für uns sein. Im Gegensatz zu den beleuchteten, mit Drahtseilen und gesicherten Wegen versehenen Höhlen in Europa oder USA, waren die Bat Caves nämlich einfach Höhlen in ihrem ursprünglichem Zustand. Alleine wären wir voraussichtlich gerade einmal bis zur Mitte der ersten Höhle vorgedrungen und hätten uns nie im Leben durch den engen Felsspalt am Ende gequetscht, um dann später auf dem Hintern einen schlammigen Stein herabzurutschen und dann von Stein zu Stein über einen Abgrund zu springen. Junior und mir ging das eine oder andere Mal Uncharted (ein Videospiel) durch den Kopf. Wir waren die einzigen Besucher und hatten viele Fledermäuse (Bat Cave!), Schwalben, giftige Tausendfüßler, Spinnen, Skorpione, Stalagmiten und einen Höllenspaß.Und eine kleine Prellung am Fuß, aber so etwas muss man in Kauf nehmen.
Hinterher gab es einen kleinen Snack und ein Belohnungsbintang in der nahe gelegenen Eco Lodge (unter den kritischen Blicken einiger Langschwanzmakkaken, die auf dem Zaun saßen und auf Abfälle lauerten). Die 250 Stufen zur Lodge (habe ich die eigentlich schon erwähnt?) erklommen wir heute etwas schneller als sonst, weil es anfing zu regnen.
Jetzt Pause und morgen dann 8 Stunden Autofahrt zum Lake Toba, auf die wir uns alle schon mächtig freuen.
21.8. – Bukit Lawang-Lake Toba
Wenn man abseits jeglicher Zivilisation mitten im Dschungel wohnt, hört man viele eigentümliche Geräusche: Kreischen, Zischen, Zirpen, Grunzen, Plätschern. Ein Urwaldkonzert. Zu den Geräuschen, die man nicht erwartet, zählen eine Doors-Coverband, gefolgt von Techno und Rave in Lautstärke „this one goes to eleven“ und Bässen, die das Moskitonetz zum vibrieren bringen. Nachdem wir heute eine frühe Abreise hatten, gingen wir gestern alle etwas früher ins Bett und fielen damit alle gleichzeitig aus demselben, als das wöchentliche Bukit-Lawang-Disco-Event begann. Unsere Behausung lag zwar relativ weit oben am Hang (etwa 250 Stufen…), aber direkt dem Tal zugewandt. Ziemlich genau unter uns wurde ab 22 Uhr ein Festival der Ravemusik abgefeuert und das bis 4 Uhr morgens. Man glaubt gar nicht, welche subtilen Foltermethoden einem zwischen 2 und 4 Uhr morgens durch den Kopf gehen können.
Nach 2 Stunden Schlaf ging dann heute unsere Fahrt von Bukit Lawang zum Lake Tabo los. 250 Kilometer, für die man auf Sumatra etwa 9-10 Stunden kalkulieren muss. Die Straßen hier bestehen zu guten Teilen aus Schlaglöchern, in denen ganze Basketballmannschaften auf Nimmerwiedersehen versinken können (Ursache: Palmölplantagenschwerkraftfahrzeuge i.V.m. klimabedingter Erosion). Streckenweise spielt sich der gesamte Verkehr – in beiden Richtungen – auf einer breite von 50 cm ab, weil der Rest der Straße einfach nicht mehr nutzbar ist; und diese 50 cm werden dann auch noch gerne von marodierenden Herden unterernährter Rinder bevölkert.
Die uns empfohlene Route führte über das malerische, auf 1.500m ü.N.N.gelegene Bergdorf Berastasi, auf dem wir nach etwa 5 Stunden Fahrt einen Stop zum Lunch eingelegt haben. Das malerische Bergdorf entpuppte sich leider als unspektakulärer Mix von Vergnügungsparks, Stundenhotels und schäbigen Restaurants. In einem solchen aßen wir dann auch übellaunig (2 Stunden Schlaf!) mit herrlichem Blick auf die Hauptstraße zu Mittag. Das Wetter passte zur Stimmung. Es war so bewölkt, dass man die 3 umliegenden Vulkane nur erahnen konnte.
Unser sehr bemühter Fahrer legte dann noch einen Zwischenhalt am berühmten Obst- und Gemüsemarkt von Berastasi ein, der auch wirklich bunt und sehenswert war (aufgrund des Höhenklimas wachsen da oben so ziemlich alle leckeren Sachen von Kaffee über Maracuja bis hin zur Jackfruit), führte uns zu einem spektakulären Wasserfall und einem ausgedienten Königspalast. Hier wie dort fiel wieder auf, wie untouristisch Sumatra ist: Es waren nur Indonesier unterwegs, die des öfteren kichernd auf uns zukamen, um mit einem von uns (bevorzugt der langbeinigen blonden Tochter, oder dem sehr hohen und breiten Vater) vor dem Smartphone zu posieren.
Nach insgesamt 10,5 Stunden kamen wir dann um 17:30 ziemlich erledigt am Fährhafen von Parapat an, von wo uns um 18:00 die Fähre nach Tuk Tuk, der „Hauptstadt“ von Samosir übersetzen sollte. Nach dem ruckeligen Tag und der schlaflosen Nacht, war es dann ganz angenehm, dass uns die Fähre direkt am Hotelanleger abgesetzt hat und dass wir hier keine 250 Stufen zu erklimmen hatten.
Der Lake Toba ist mit einer Gesamtfläche von 1.776,5 km2 mehr als 3 mal so groß wie der Bodensee (536 km2), der größte See in Indonesien und der größte Kratersee der Erde. Die 647 km2 große Halbinsel Samosir ist größer als der Staat Singapur. Um das zu erkunden, haben wir jetzt ganze 2 Tage Zeit. Bis morgen!

22.8. – Tuk Tuk, Samosir Island, Lake Toba, Sumatra
Das Tabo Hotel am Toba See. Da hat jemand ganz viel Humor bewiesen (vielleicht ja die deutsche Betreiberin). Da wohnen wir jedenfalls zu viert in einem traditionellen Batak-Haus mit einem an beiden Enden zipfelartig nach oben geschwungenen Dach. Es ist etwas dunkler, als ein normales Haus und alle wohnen, typisch indonesisch, in einem großen Raum. Im Gegensatz zum On the Rocks gibt es hier warmes Wasser – hurra!
Nach dem ausführlichen Frühstück wurde der Beschluss gefasst, sich Scooter auszuleihen und einfach über die Insel zu düsen. Mopeds sind das indonesische Hauptverkehrsmittel, insofern ist das die beste Art und Weise, sich unter die Bevölkerung zu mischen. Gegenüber vom Hotel ist Erics Souvenir/Telefone/Internet/Scooter Rental/Grocery Laden und dort bekamen wir für 100.000 IDR (6,80€) sehr amtliche Fahrzeuge mit etwa 70 km/h Spitze.
Zum Ausprobieren sind wir damit erst einmal rund um unser kleines Halbinsel-Dorf Tuk Tuk gefahren, das funktionierte schon recht gut. Dann sind wir die Hauptstraße Richtung Norden gefahren, um dort eigentlich das Freilichtmuseum Huta Bolon zu besichtigen. Eigentlich, weil die Tochter dann krank wurde (die war die ganze Zeit schon irgendwie schlapp und kränklich) und wir alle deswegen umdrehen mussten. Auch die zurückgelegte Strecke war aber schon herrlich. Gut geteerte Straßen, kein Verkehr, freundliche Menschen und Horden von Schulkindern, die alle schon ganz ordentlich Englisch sprachen und stolz für die Fotos posierten.
Nachdem wir Tochter und Frau (als Krankenschwester) am Hotel abgeliefert hatten, fuhren Junior und ich dann noch einmal auf der Küstenstraße Richtung Ambarita, wo wir auf Dreiviertel der Strecke am Vormittag ein sehr nett aussehendes kleines Restaurant entdeckt hatten. Weit weg von jeglicher Zivilisation, mitten im Nirvana, aber herrlich gelegen mit fantastischer Sicht über den See. Dort gab es dann auch noch hervorragendes Essen und frisch gepresste Fruchtsäfte für umgerechnet 70 ct. Auf die Frage, ob die Säfte aus der Konserve, oder frisch seien, meinte der Besitzer nur: „Look around! It all grows beside our house.“
Für den abend hatten wir bereits „Batak Feast“ (eine Auswahl lokaler Spezialitäten) für 4 Personen in einem einheimischen Restaurant („Maruba“) vorbestellt, das auf travelwiki sehr gelobt wurde, aber recht schwer zu finden war. Leider waren wir aufgrund des Ausfalls der Tochter nur zu dritt und haben nicht alles geschafft. Aber toll war’s!
Morgen geht’s mit den Mopeds auf den Berg…

23.8. – Samosir Island, Lake Toba, Sumatra
Während ich dies hier schreibe, wird hinter mir in der hoteleigenen kleinen Kaffeerösterei gearbeitet und ein unbeschreiblich herrlicher Kaffeeduft zieht vorbei. Aufgrund des höhenbedingt angenehmen Klimas (Lake Toba liegt auf ca. 900m N.N.) wächst hier alles im Überfluss, auch Kaffee. Man pflückt ihn, röstet ihn und trinkt ihn, so wie wir in Deutschland eine Tomate aus dem Garten holen.
Plangemäß sind wir heute mit den Mopeds (amtliche 125 ccm Fahrzeuge mit ordentlich Schwung) so weit wie möglich den Ronggurnihuta, die höchste Erhebung Samosirs, hoch gefahren. Die Wege waren ausnahmsweise weder auf Google Maps, noch auf Openstreetmap verzeichnet, so dass man auf gut Glück erforschen musste, wolang man fuhr.
Nach Angabe des Hotels würde erst ein Stück gute Straße kommen, dann wieder ein Stück sehr schlechte Straße und dann wieder gute Straße. Dies als Maßstab nehmend, sind wir immer fröhlich den Berg hinaus, bis die Straße plötzlich wieder abwärts führte. Nachdem wir das kleine Stück zwischendrin mit den Schlaglöchern nach unserer Erfahrung aus Bukit Lawang nicht wirklich als „schlechte Straße“ wahrgenommen hatten, sind wir einen kleinen Feldweg bergauf gefahren, den wir schon eher als anspruchsvoll bezeichnet hätten. Zeitweise hatte das schon Motocross-Qualität. Irgendwo in the middle of nowhere (Laut GPS 1.500 m ü. N.N.) rumpelte uns dann ein 4W-LKW entgegen, dessen Fahrer uns entgeistert fragte, wohin wir denn wollten und uns ans Herz legte, doch besser umzudrehen, weil die Straße jetzt dann doch eher schlecht werden würde.
Das taten wir dann auch, kehrten an einem herrlichen Aussichtspunkt ein, fuhren zurück nach Ambarita und besichtigten dort den ‚Stone Chair Of King Siallagan‘. Bis ins frühe 19. JH gab es dort, am Sitz des Königs, Sitzungen des Gerichts. Im Falle von Mord, Ehebruch und Spionage wurde das Todesurteil ausgesprochen. Der Delinquent wurde nach Urteilsspruch noch eine Woche lang gemästet und dann zunächst gefoltert, danach mit Gewürzen eingerieben und schließlich geköpft, zerkleinert und verzehrt. Jeder Dorfbewohner musste ein Stück Verbrecher verzehren (wer sich weigerte, wurde selbst geköpft). Der Weg aus dem Freilichtmuseum führte durch ein Labyrinth aus Touristen-Nepp-Läden und war die eigentliche Herausforderung des Tages…
Danach fuhren wir noch einmal in das nette kleine Restaurant im Nirvana von gestern, tranken da einen Fruchtsaft, aßen ein Nasi Goreng und lieferten die nörgelnde Tochter im Hotel ab. Anschließend machten wir uns dann zu Dritt noch einmal auf den Weg zum Nordzipfel der Insel.
Schee war’s! Morgen geht’s dann schon wieder zurück nach Medan. Ich halte Euch auf dem Laufenden.

24.8. – Samosir-Medang, Sumatra
Ein Relax-Urlaub ist das bislang nicht. Nach der Horrornacht im Urwald mit Rave-Party bis um 4 Uhr morgens, hatten wir jetzt 3 Nächte mit einem Haufen notgeiler Gockel, die ab 04:30 rausgehauen haben, was geht. Jaja, ich höre euch sagen „Natur, Hajo, Natur!“ – aber die Natur kann mich mal kreuzweise, wenn sie mich jeden Morgen im Dunkeln aus dem Bett schmeißt! Um es kurz zu machen: Direkt neben unserem Hotel in Medang, in dem ich hier gerade sitze, jodelt sich ein Muezzin die Seele aus dem Leib und ich weiß aus Erfahrung, dass die Jungs auch morgens im Dunkeln wieder anfangen, den Herren zu preisen. Wehe, unser Haus in Bali liegt auch nur ansatzweise in der Nähe irgendeiner Geräuschquelle. Dann werde ich zum Tier!
Die Nacht war unruhig. Es hat geschüttet wie aus Kübeln und gestürmt wie in der Kulisse vom fliegenden Holländer. Zwischendurch musste ich aufstehen und Handtücher unter die tropfenden Dachstellen legen. Um 04:30 dann die Hähne. Der Vormittag heute war hingegen ruhig. Frühstück, Klamotten in die Tasche packen und sogar noch eine Massage war drin‘.
Dann hieß es ‚good bye, Lake Toba!‘ – der Gedanke, im größten Vulkankrater der Welt in einem Kratersee auf einer Insel zu sitzen, die einst der Kraterboden war, der nach der Eruption nach oben gedrückt wurde, ist schon beeindruckend. Die Tatsache, dass dieser gigantische Vulkanausbruch vor 70.000 Jahren die Temperatur weltweit um 3 Grad gesenkt und entscheidend zur 2. Eiszeit beigetragen hat, ebenfalls.
Mit dem Boot über den Kratersee, in der Hoffnung, dass dort unser gebuchter Fahrer auf uns warten würde. Tat er aber nicht. Ein Anruf im Hotel (über das wir den Transfer gebucht hatten) ergab, dass die es verpennt haben, den Fahrer zu organisieren. Shit happens. Also wurde vor Ort ein Transfer organisiert. Nach anfänglichem Herumgschleiche und dem Hinweis an den Fahrer, er könne ruhig indonesisch fahren, wurde die Fahrt dann munterer und wir unterschritten die angekünndigte Fahrzeit von 5,5h um eine Stunde. Von den 4,5h Fahrzeit entfielen übrigens 45 Minuten auf die letzten 10 Kilometer in Medan. The Horror.
Sumatra ist sicherlich auch deswegen so untouristisch, weil man für das Reisen sehr viel Zeit braucht und die Infrastruktur einfach grottenschlecht ist. Im Gegensatz zu den letzten durchlöcherten 30km in Bukit Lawang war die Straße heute zwar pures Gold,,,,,, aber man hängt dauernd hinter irgendwelchen abgewrackten LKWs, an denen die Karosserieteile nur noch an durchkorridierten Stahlzügen baumeln und die große schwarze Rußwolken durch den Auspuff blasen.
Der Weg heute führte durch kilometerlange Kautschuk- und Palmölplantagen, Mopeds umrundeten uns wie X-Fighter den imperialen Schlachtkreuzer. Manche schwer beladen mit Tieren, Lebensmitteln, oder mit einigen Tonnen Bananen. Falls ich je ein Road-Movie drehen wollte – Sumatra wäre die Kulisse!
Im Hotel „Omlandia Deli River“ angekommen, fiel als erstes die herrliche Ruhe auf. Eine grüne Oase in der Millionenstadt Medan. Herrlich. Als zweites fiel das WLAN-Password auf: hdroml88 hier und omlhdr88 dort. Die „88“ kennt man ja aus einschlägigen Kreisen und die Recherche ergab, dass „Omlandia“ eine holländische Studentenverbindung war. Honi soit, qui mal y pense… Wir reisen ja morgen wieder ab.
Die angekündigte Fahrzeit für die 15 km zum Flughafen morgen sind 1,5 Stunden. Naja. Fahren wir eben früher los.

25.8. – Sumatra-Bali
Teil 1 – The road movie continues
Und mal wieder ein Reisetag. Für den 40km-Transfer vom Hotel zum Flughafen brauchen wir 75 Minuten. Gebucht ist Citilink, eine Airline, die auf irgendwelchen schwarzen Listen steht und weder bei Flighttrack, noch bei Checkmytrip zu finden ist. Eigentlich aber alles ganz ordentlich hier (famous last Words? Ich schreibe das gerade an Bord). Wir fliegen Medan (Kualanamu) – Bandung (auf Java) – Bali (Denpasar) und haben aktuell 45 Minuten Verspätung. Auf Bali werden wir dann – hoffentlich – abgeholt und sind noch eine ganze Weile bis in den Norden unterwegs. Wenn ich mich richtig erinnere, locker noch einmal 3-4 Stunden.
Das war’s dann also mit Sumatra und damit dem eher abenteuerlichen Teil unseres Trips. Zeit für ein Zwischenfazit: Inklusive der Anreise via Dubai (>1 Tag), den Transfers von Medan nach Bukit Lawang (¾ Tag), von dort zum Lake Toba (1 Tag) und zurück nach Medan (½ Tag) sowie dem heutigen Reisetag waren wir jetzt 5 Tage quasi auf der Straße oder in der Luft. Den Stopover-Tag in Singapur nicht mitgerechnet. In 10 Tagen haben wir 4 Flüge, 5 Transfers und 4 verschiedene Hotels genossen.
Wer jeden Urlaubstag auch als solchen ausnutzen will, ist sicherlich mit einem einfachen Hin- und Rückflug nach Irgendwo besser bedient. Wir haben jetzt vom Minibusfahren auch erst einmal die Nase voll. Andererseits haben wir Gorillas so hautnah gesehen, dass wir vor ihnen einmal Reißaus nehmen mussten, sind durch den Dschungel und ein Höhlensystem geklettert, haben in heißen Quellen und unter Wasserfällen gebadet, auf einer Insel im größten Kratersee der Welt übernachtet, sind mit 125ccm-Mopeds bergauf und bergab gedüst und haben mehr Sachen erlebt, als bei 10 Mallorca-Urlauben. Von Land und Leuten, den Straßen und dem Drumherum ganz zu schweigen.
Vor vielen Jahren in Sulawesi (einer anderen sehenswerten Insel Indonesiens) haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht, wurden spontan von Einheimischen zum Festmahl eingeladen und haben an einer Beerdigungszeremonie im Urwald teilgenommen, bei der alle Gäste Schweine und Rinder mitbrachten, die dann in einer eigens erbauten Bambusarena geschlachtet, vor Ort zerkleinert wurden und in Bambusrohren mit Gemüse gegart zur Bewirtung der Gäste dienten.
Für jeden, der einen Funken Marco Polo (für die Jüngeren: Das war so eine Art Indiana Jones, bevor Spielberg geboren wurde) in sich hat, ist Indonesien vor allem abseits der eigetretenen Pfade ein ganz tolles Reiseland. Das Reisen ist günstig, das essen ist gut (also nicht ganz so fein, wie in Thailand, aber immer noch sehr gut) und man kommt auch mit den einheimischen Bussen immer von A nach B und alle Menschen sind ausgesprochen freundlich und hilfsbereit. Und zwar nicht die Art Hilfsbereitschaft, die dazu geführt hat, dass ich mittlerweile arabische Länder tendenziell vermeide, weil doch oft irgendein Hintergedanke dabei ist, sondern eine ganz herzliche, offene Hilfsbereitschaft, die nicht unbedingt auf ein Trinkgeld aus ist (das man dann natürlich um so lieber gibt).
Teil 2 – Angekommen! \o/
Hallo Bali! Nach einem insgesamt erfreulich problemlosen Flug mit kurzem Stopover in Bandung (bei dem wir sitzen bleiben konnten) sind wir in Bali angekommen und wurden sogar vom Fahrer abgeholt. Denpasar war wie üblich ein einziger Stau. Alleine aus dem Flughafengelände zu kommen, dauerte 20 Minuten. Der Trip hier zur Villa dann noch einmal 3,5 Stunden (die dürft ihr zu den oben genannten Transferzeiten dazurechnen). Puh! Irgendjemand hat mitgedacht und in unserem Ferienhaus Bier in den Kühlschrank gestellt. Halleluja! Und gute Nacht